Der Fall Wolfgang Beltracchi
Wolfgang Beltracchis Vater war dazumal Restaurator und Kirchenmaler. Beltracchi durfte als Jugendlicher seinen Vater auf die Arbeit begleiten und ihm dabei öfter helfen. Durch die Restaurationsarbeiten mit seinem Vater lernte Beltracchi damals schon die Grundzüge des Kopierens resp. Restaurierens kennen. Der 14-Jährige Wolfgang zeichnete in wenigen Stunden eine perfekte Reproduktion eines Picasso-Bildes. Ab da fasste der Vater nie mehr einen Pinsel an. Beltracchi gefielen jedoch nicht alle Bilder der „alten Meister“ und so entwickelte er sie weiter, beispielsweise lies er auf einem Picasso-Bild ein Tuch weg und gestaltete es monochrom.
35 Jahre lang arbeitete Beltracchi völlig unerkannt und flutete den Kunstmarkt mit seinen Kopien grosser Maler wie Max Ernst, Max Pechstein, André Derain und Kees van Dongen. Im Privaten lebt er im Luxus, kauft sich eine Villa an der Cote d’Azure und in Freiburg im Breisgau. Materialien und Utensilien aus der Zeit der kopierten Künstler fertigte Beltracchi zum einen Teil selbst an oder erwarb sie. Leinwände aus der Originalzeit, Farbpigmente und die Nass-in-Nass-Signatur mussten täuschend ähnlich sein. Für den Trocknungsvorgang der Farben konzipierte er selbst einen Ofen. Auf der Rückseite der Bilder wurde der Keilrahmen mit falschen Etiketten nicht mehr existierender Galerien versehen. Angefertigt wurden diese Etiketten aus zeitgenössischem Papier, welches danach mit Tee nachgedunkelt und mit eigens angerührtem Klebstoff versehen wurde. Immer an seiner Seite: Seine Frau Helen Beltracchi. Helen war für den Vertrieb der gefälschten Werke in den Galerien zuständig. Was er malte, verhökerte sie geschickt, charismatisch auf dem Kunstmarkt – zwei Zockerseelen hatten sich gefunden. Brauchte Wolfgang ein „falsches Motiv“ spielte Helen für ihn das Model und posierte bis er sein Werk vollendete. Galerien in Paris, Zürich, London und New York stellten die Kunstfälschungen nichtsahnend aus. Ein Werk soll sogar im Haus des Hollywood-Filmstars Steve Martin stehen.
Im Jahre 2010 nahm jedoch die ganze Schwindelei ein jähes Ende. Die maltesische Firma Trasteco erwarb eine Imitation von Campendonks „Rotes Bild mit Pferden“ der Galerie Lumpertz für den Betrag von 3 Millionen CHF. Dabei wussten der Käufer wie der Galerist (noch) nicht, dass das Bild aus der Hand Beltracchis stammte. Die Firma Trasteco liess das Bild naturwissenschaftlich auf die Echtheit überprüfen. Die Untersuchung fand auf der Leinwand Spuren von Titanweiss, das es zur angeblichen Entstehungszeit des Bildes noch gar nicht gab. Beltracchi erklärte später, dass ihm an diesem Tag die benötigten Pigmente fehlten und er deswegen Zinkweiss aus einer Tube von Holland verwendet hatte. Auf der Tube stand jedoch nicht drauf, dass die Farbe auch ein bisschen Titanweiss enthielt.
Am 27. August 2010 wurde gegen Wolfgang Beltracchi von der Firma Trasteco Strafanzeige eingereicht. Im Oktober 2011 wurde er in Gewahrsam genommen. Inzwischen wird angenommen, dass Beltracchi über 200 Nachahmungen von Werken aus der Moderne anfertigte. Der Einfachheit halber wurde er nur aufgrund von 14 Exemplaren angeklagt, welche einen Gesamtschaden von rund 35 Millionen CHF verursachten. Wolfgang Beltracchi wurde zu sechs Jahren Freiheitsentzug und seine Frau Helen wurde wegen Beihilfe zu vier Jahren verurteilt. Getrennt von einander verbrachten die beiden ihre Gefängnisstrafe im offenen Vollzug.
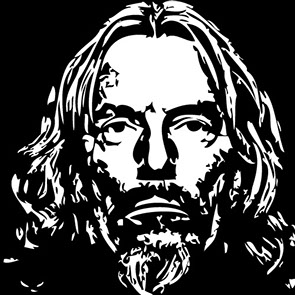
Die Ausstellung bei Brügger
Impressum:
Webseite von 3 Studenten über Kunstfälschung mit Fokus auf den Fall von Wolfgang Beltracchi.
Kontakt:
Taddeo Cerletti
Elia Gianini
Gian Zarotti